Buchkritik + Stellungnahme „Helfen – als Profession (Problem Arbeitslosigkeit)“

Stellungnahme zur Kritik zum Buch „Helfen – als Profession (Problemfeld Arbeitslosigkeit)“
Ich danke für die sachlichen und konstruktiven Rückmeldungen zu meinem Buch „Helfen – als Profession“.
Vorab:
Das Werk versteht sich nicht als wissenschaftlicher Abschlussbericht, sondern als Impuls- und Reformbeitrag für eine wirksamere, menschlichere und verantwortungsbewusstere Sozialpolitik.
Die Betonung von Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung soll strukturelle Ursachen sozialer Problemlagen nicht negieren, sondern das Gleichgewicht zwischen individueller Verantwortung und gesellschaftlicher Solidarität (Fordern und Fördern) wiederherstellen.
Ebenso sind die Reformvorschläge – etwa „Jobcenter als Potenzialagenturen“ oder eine höhere Vermittlungsquote – bewusst ambitioniert gedacht: nicht als Utopie, sondern als Orientierung für Veränderung.
Ich stimme zu, dass weitere empirische Vertiefung, internationale Vergleiche und Betroffenenperspektiven wertvolle Ergänzungen darstellen.
Das Buch will genau dazu anregen – zu offener, faktenbasierter und mutiger Diskussion darüber, wie Hilfe wirklich helfen kann.
Sozial ist, wer die richtigen Dinge gut tut – und wer bereit ist, Bestehendes zu hinterfragen.
Das Werk versteht sich als impulsgebender Beitrag zur Weiterentwicklung der sozialen Hilfe im Kontext von Arbeitslosigkeit – nicht als abschließende wissenschaftliche Theorie, sondern als Einladung zur Diskussion darüber, wie Hilfe wirksam, menschlich und verantwortungsvoll gestaltet werden kann.

Kernaussagen & Leitidee im Überblick „Helfen – als Profession“ (Henryk Cichowski, 2025)
Hilfe darf nicht verwalten, sondern muss befähigen.
Ziel professioneller Hilfe ist Selbstwirksamkeit statt Abhängigkeit – erfolgreiche Hilfe macht sich überflüssig.
1. Grundgedanke
- Hilfe soll Übergang, nicht Dauerzustand sein.
- Wirksamkeit misst sich daran, ob Menschen eigenständig werden.
- Stärkenorientierung und Selbstverantwortung stehen im Zentrum.
- Der Sozialstaat soll Transformation statt Stillstand fördern.
2. Menschenbild und Verantwortung
- Jeder Mensch hat Stärken und Potenzial (anthropologisch-optimistische Grundlage, vgl. 1. Korinther 12).
- Gleichzeitig: Neigung zur Bequemlichkeit (Kant).
- Verantwortung ist zweiseitig – individuell (Eigenverantwortung) und gesellschaftlich (Solidarität).
- Dauerhilfe birgt das Risiko der Stigmatisierung und „erlernten Hilflosigkeit“.
3. Systemkritik
- Bürokratische Entmündigung: Hilfe wird zum Verwaltungsakt.
- Grundsicherung als Falle: Sie sichert das Überleben, aber kaum Wege in Selbstständigkeit.
- Ineffizienz: Vermittlungsquoten unter 6 %, trotz über 100.000 Beschäftigten in BA/Jobcentern.
- Selbsterhaltende Hilfesysteme (Luhmann): Hilfeinstitutionen haben ein Eigeninteresse an ihrem Fortbestand.
- Kostenexplosion: 70 Mrd. € jährlich für Erwerbslosigkeit, geringe Wirkung.
4. Problemfeld Arbeitslosigkeit
- 3 Mio. Arbeitslose (1 Mio. langzeitarbeitslos), 1,2 Mio. offene Stellen.
- Nur 5–6 % Vermittlungserfolg p. a. → 94 von 100 werden nicht vermittelt.
- „Mismatch“-Erzählung verschleiert strukturelles Versagen der Arbeitsverwaltung.
- Die Arbeitsverwaltung produziert Routine, aber keine nachhaltige Integration.
5. Leitkonzept: Empowerment & Anschlussdenken
- Empowerment statt Betreuung – Menschen befähigen, nicht managen.
- Anschluss statt Match – echte Integration über Beziehungen und Netzwerke.
- Jobcenter als Potenzialagenturen – Fokus auf Stärken, nicht Defizite.
- Qualifizierung im Unternehmen, nicht im „Maßnahmenkarussell“.
- Arbeitgeber als Mitverantwortliche für Integration und Personalentwicklung.
- Unabhängige Forschung: Trennung von IAB und BA, jährliche Evaluation.
6. Reformziele
- 20 % Vermittlungserfolg jährlich (statt 6 %).
- Personalabbau in Jobcentern/BA von 100.000 → 30–50.000.
- Milliardeneinsparungen für Bildung, Pflege, Klima, Kultur.
- Jobcenter der Zukunft: unabhängig, wirksam, menschlich.
7. Philosophisch-theoretische Fundamente
- Kant: Menschen müssen zur Selbstbestimmung geführt werden – Hilfe darf Bequemlichkeit nicht fördern.
- Luhmann: Hilfe ist ein System mit Eigenlogik; sie kann sich selbst perpetuieren.
- Lincoln: „Man helps people not by doing for them what they can and should do for themselves.“
- Herriger / Pelz: Empowerment als Kern professioneller Sozialarbeit.
8. Fazit / Schlussplädoyer
Ein gerechter und starker Sozialstaat des 21. Jahrhunderts muss Mut zur Wirksamkeit haben.
Sozial ist, wer die richtigen Dinge gut tut – nicht wer am lautesten für mehr Geld ruft.
Ziel ist eine Kultur der Selbstbefähigung, nicht der Dauerabhängigkeit.
„Wer wirklich hilft, macht sich überflüssig – das ist kein Verlust, sondern der höchste Erfolg professioneller Hilfe.“
9. Bedeutung für Politik und Praxis
- Politik: braucht Mut zur Systemkritik und Reform.
- Sozialberufe: sollen Selbstwirksamkeit erzeugen, nicht Verwaltung bedienen.
- Wissenschaft: muss unabhängig forschen.
- Gesellschaft: trägt Mitverantwortung für Solidarität und Eigeninitiative.

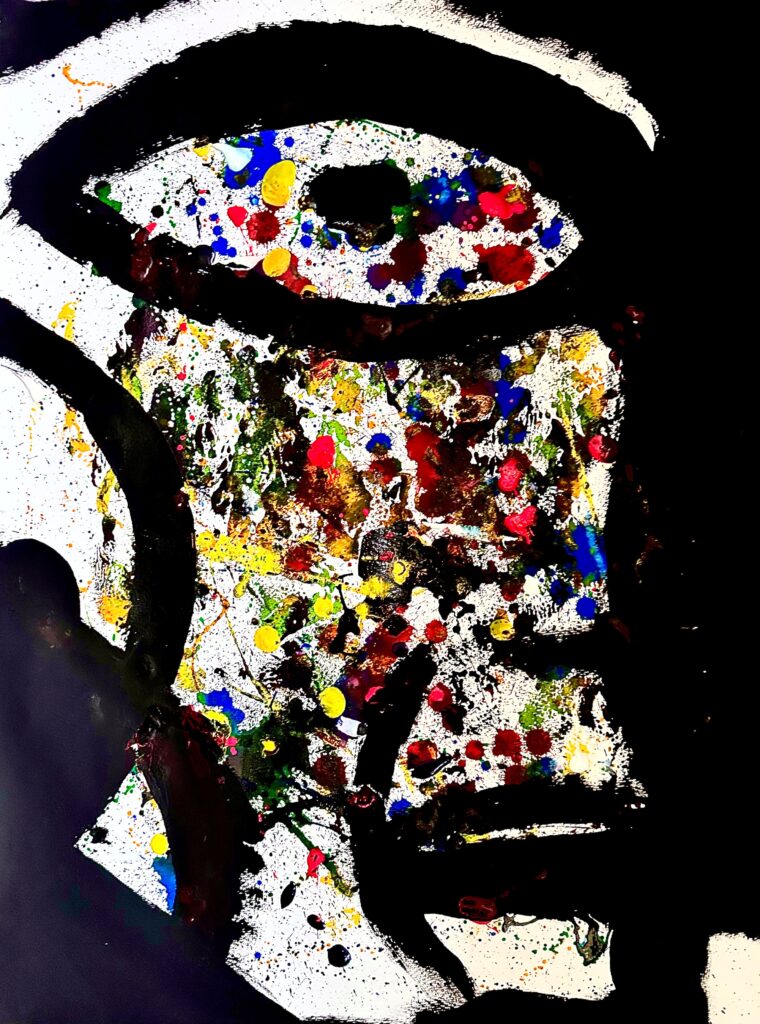
Kritikpunkte von Dr. Franz M. Müller
(HR – Manager und Personalvorstand a. D.):
Starke Fokussierung auf Eigenverantwortung
o Das Buch betont die Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung der Hilfesuchenden sehr stark.
o Kritiker könnten einwenden, dass strukturelle Barrieren wie Diskriminierung, psychische Erkrankungen oder Bildungsbenachteiligung nicht ausreichend gewürdigt werden.
Idealistische Reformvorschläge
o Die Vision von Jobcentern als „Potenzialagenturen“ und die Forderung nach einer Vermittlungsquote von 20 % p. a. sind ambitioniert.
o Hier wäre eine realistische Einschätzung, wie diese Ziele unter den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen umsetzbar wären, hilfreich
Empirische Evidenz (Nachweise)
o Obwohl viele Zahlen und Statistiken genannt werden, bleibt die wissenschaftliche Fundierung der Reformvorschläge eher allgemein.
o Eine tiefergehende empirische Analyse oder Evaluation bestehender Modelle wäre hilfreich, um die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Ansätze zu belegen.
Kritik an Institutionen ohne differenzierte Betrachtung
o Die Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter werden teils pauschal als ineffizient dargestellt.
o Sicherlich gibt es auch positive Entwicklungen, regionale Unterschiede oder engagierte Mitarbeitende???
Fehlende Perspektiven der Betroffenen
o Du spricht viel über Arbeitslose, aber wenig mit ihnen.
o Eine stärkere Einbindung von Erfahrungsberichten oder qualitativen Stimmen der Betroffenen könnte die Argumentation menschlicher und differenzierter machen.
Internationale Vergleichsstudien
o Es werden zwar Beispiele aus Europa genannt (z. B. Dänemark, Niederlande, Schweiz), aber eine systematische Gegenüberstellung fehlt.
o Wie schneiden andere Länder bei der Arbeitsmarktintegration ab – und warum?


Antwort von Henryk Cichowski auf die Anmerkungen und die Kritik
Vielen Dank für die differenzierten und konstruktiven Hinweise. Ich schätze sehr, dass du dich mit dem Text so gründlich auseinandergesetzt hast.
Mein Anliegen ist es, Denkanstöße zu geben und das Thema „Helfen als Profession“ aus einem etwas anderen, vielleicht auch unbequemeren Blickwinkel zu beleuchten.
Im Folgenden möchte ich zu den zentralen Kritikpunkten Stellung nehmen:
Zur Betonung der Eigenverantwortung
Es ist richtig, dass das Buch die Themen Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung stark hervorhebt. Denn Eigenverantwortung ist im gegenwärtigen Hilfesystem untergewichtet, während strukturelle Faktoren in Politik und Wissenschaft sehr präsent sind.
Das geschieht nicht, um strukturelle Ursachen sozialer Problemlagen zu relativieren, sondern um ein Gegengewicht zu setzen.
In der sozialpolitischen Debatte werden strukturelle, bildungs- oder herkunftsbedingte Faktoren häufig ausführlich thematisiert – während die Frage der individuellen Mitverantwortung oftmals zu kurz kommt.
Ich plädiere für eine Balance zwischen Struktur und Subjekt: Hilfe muss Rahmenbedingungen schaffen, die befähigen und vor allem Anschluss herstellen aber sie darf den Einzelnen nicht seiner Gestaltungsfähigkeit berauben.
Es geht nicht um „Selbst schuld“, sondern um Selbstwirksamkeit als Ziel professioneller Hilfe.
Die Betonung von Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung soll keine strukturellen Ursachen leugnen. Sie soll lediglich daran erinnern, dass soziale Hilfe immer beides braucht – Unterstützung durch Strukturen und die Bereitschaft des Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen. Das eine funktioniert ohne das andere nicht nachhaltig.
Zu den ambitionierten Reformvorschlägen
Die Vorstellung von Jobcentern als Potenzialagenturen und einer Vermittlungsquote von 20 % jährlich ist bewusst ambitioniert formuliert – keine Utopie, sondern eine Richtungsvorgabe
Ziel ist nicht, eine sofortige Umsetzung zu versprechen, sondern eine neue Perspektive auf Wirksamkeit zu eröffnen.
Ein Ziel von 20 % bedeutet schlicht: Verdreifachung der Wirksamkeit bei gleichem Mitteleinsatz – das sollte in einem Hochleistungsstaat nicht unrealistisch sein.
Natürlich sind politische, ökonomische und organisatorische Bedingungen herausfordernd, aber Stillstand ist keine Option. Reformen beginnen immer mit ambitionierten Zielbildern.
Ja, die Vorstellungen wie „Jobcenter als Potenzialagenturen“ oder eine Vermittlungsquote von 20 % sind bewusst ambitioniert.
Veränderung beginnt selten mit kleinen Erwartungen. Veränderung beginnt immer mit anspruchsvollen Zielbildern. Gerade im Bereich der Arbeitsmarktintegration, in dem derzeit nur etwa 5–6 % der arbeitslosen Menschen pro Jahr erfolgreich vermittelt werden, ist ambitioniertes Denken kein Luxus, sondern Notwendigkeit.
Ich halte diese Zielmarke nicht für utopisch, sondern für realistisch erreichbar, wenn Bürokratie abgebaut, Verantwortlichkeiten neu verteilt und Arbeitgeber aktiv eingebunden werden.
Zur empirischen Fundierung
Das Buch stützt sich auf vorhandene Daten (BA, IAB, Destatis, wissenschaftliche Veröffentlichungen), erhebt aber keinen Anspruch auf eine umfassende Primärforschung. Das Buch versteht sich als konzeptioneller Beitrag, nicht als Forschungsbericht.
Es soll Impulse für zukünftige empirische Evaluationen geben – insbesondere für unabhängige Wirksamkeitsforschung außerhalb der Bundesagentur für Arbeit.
Ich stimme zu, dass die wissenschaftliche Überprüfung der vorgeschlagenen Reformansätze ein nächster, notwendiger Schritt ist.
Das Buch liefert dafür die konzeptionellen Grundlagen, nicht die Endergebnisse.
Zur Kritik an Institutionen
Die Kritik richtet sich nicht gegen die Menschen, die in Jobcentern oder der Bundesagentur für Arbeit tätig sind – viele leisten hervorragende Arbeit.
Mein Fokus liegt auf den institutionellen Strukturen und Zielsystemen, die oft verhindern, dass diese engagierte Arbeit ihre volle Wirkung entfalten kann.
Wenn ich von „bürokratischer Entmündigung“ spreche, dann meine ich die systemische Logik, nicht die Haltung der Mitarbeitenden.
Ziel ist nicht Abwertung, sondern Ermutigung zur Veränderung: hin zu einer Organisationskultur, die Potenziale stärkt statt Defizite verwaltet. Also kein „Bashing“, sondern die Freisetzung von Wirksamkeit, die durch Bürokratie und Zielkonflikte bislang gehemmt wird.
Zu den Perspektiven der Betroffenen
Der Hinweis, dass die Stimmen der Betroffenen selbst stärker einbezogen werden könnten, ist berechtigt.
Der vorliegende Band konzentriert sich auf Systemanalyse und Reformkonzepte. Gezielt qualitative Erfahrungsberichte und Lebensgeschichten einzubeziehen, um die theoretischen Ansätze durch persönliche Perspektiven zu ergänzen, macht Sinn, wurden aber bewusst rausgelassen.
Empowerment bedeutet schließlich auch, dass Betroffene selbst zu Wort kommen und an der Lösungsgestaltung beteiligt sind. Hier sollten insbesondere Beispiele benannt werden, wie Arbeitsmarktintegration gelungen ist und nicht was sie alles behindert.
Zu den internationalen Vergleichen
Die europäischen Beispiele (Dänemark, Niederlande, Schweiz) dienen im Buch als illustrative Hinweise darauf, dass andere Länder mit klareren Zielsystemen, stärkerer Selbstverantwortung und Aktivierung sowie Dezentralisierung deutlich bessere Vermittlungserfolge erzielen.
Eine systematische, empirisch fundierte Gegenüberstellung nationaler Strategien wäre ein wertvoller Ergänzungsschritt – den ich ausdrücklich begrüße und für künftige Projekte vorschlage.
Fazit
Das Buch ist als Appell zur Erneuerung des sozialstaatlichen Denkens gemeint. Es will den Blick schärfen für das, was Hilfe im besten Sinne leisten kann: Menschen befähigen, Übergänge schaffen und Selbstständigkeit fördern. Es fordert mehr Mut zur Wirksamkeit, mehr Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen und mehr Effizienz im Umgang mit öffentlichen Mitteln.
„Helfen – als Profession“ ist damit kein technokratisches Reformpapier, sondern ein sozialphilosophischer und praxisnaher Beitrag zur Debatte über den zukünftigen Charakter eines gerechten und starken Sozialstaates.
Das Buch will nicht alles perfekt erklären, sondern das Denken über Hilfe verändern: weg von der Verwaltung von Abhängigkeit, hin zu Stärkenorientierung, Wirksamkeit und Eigenverantwortung.
Wer helfen will, muss den Mut haben, auch das eigene System zu hinterfragen.
Ich bin dankbar, dass die Kritik genau dort ansetzt, wo Weiterentwicklung möglich ist – und ich verstehe sie als Ansporn, die Diskussion fortzuführen.
Sozial ist, wer die richtigen Dinge gut tut – und wer bereit ist, dazzulernen und Bestehendes zu hinterfragen.
Und noch etwas zum Schluss:
Stärkenorientierung statt Defizitperspektive
In meiner langjährigen arbeitsmarktpolitischen Praxis habe ich festgestellt, dass es für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration oft förderlicher ist, persönliche oder soziale Problemstellungen bewusst außen vor zu lassen. Allzu häufig lenken sie von dem eigentlichen Ziel ab – dem Anschluss an Arbeit.
Die hohe Kunst professioneller Arbeitsmarktintegration besteht meiner Überzeugung nach darin, ohne detailliertes Wissen über persönliche oder soziale Problemlagen tragfähige und konstruktive Brücken in Beschäftigung zu bauen. Entscheidend ist der Blick auf arbeitsbezogene Stärken, nicht auf Defizite.
Alle Integrationsbemühungen sollten sich daher konsequent an den beruflichen Potenzialen, Kompetenzen und Ressourcen der Menschen orientieren.
So entsteht Motivation, Selbstwirksamkeit und Zuversicht – die eigentlichen Motoren einer nachhaltigen Integration.
Zudem gilt:
- Probleme gehören den Menschen selbst.
- Sie sind Teil ihrer individuellen Lebensverantwortung.
- Wer ihnen diese Verantwortung abnimmt, schwächt sie und fördert ungewollt die Abhängigkeit von externer Hilfe.
- Professionelle Unterstützung sollte Menschen nicht entlasten, sondern ermächtigen, ihre eigenen Wege zu gehen und
- Anschluss im Arbeitsleben zu finden – das ist der Job!

Neubrandenburg, Oktober 2025





