Empowerment im Kontext von Arbeitslosigkeit
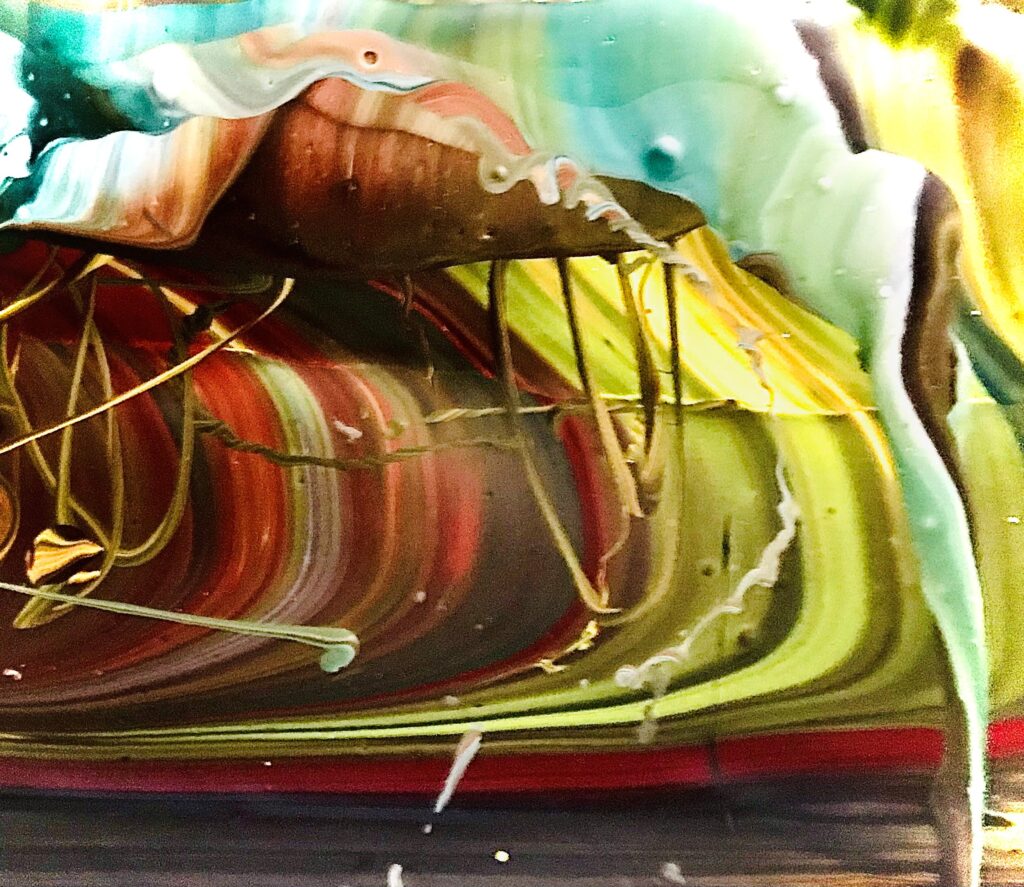
Sehr geehrte Frau Bärbel Bas.
„Sozial ist am Ende nur der, der die richtigen Dinge gut tut.
Denn soziale Hilfe (auch wenn sie noch so gut und barmherzig gedacht war) ist nur dann effektiv, effizient und gerecht, wenn sie tatsächlich den Hilfebedürftigen und am Ende nicht nur den Helfenden dient und sie die Solidargemeinschaft, also diejenigen, die das bezahlen, entlastet.“
Eine staatliche Hilfeorganisation, die p. a. lediglich 6 % ihrer Hilfebedürftigen in Arbeit bringt, hat mit Armenhilfe nichts zu tun. Das Ergebnis der Nicht-Leistung ist eher ein Armutszeugnis für eine gescheiterte professionelle Soziale Hilfe (Nächstenliebe) und damit eine enorme Belastung der Gesellschaft.
Im Ergebnis bleiben Arbeitslose arbeitslos, Unternehmen leiden weiter unter massivem Arbeitskräftemangel und die Gesellschaft muss enorme finanzielle Aufwendungen für die nicht gelöste Problemstellung Arbeitslosigkeit aufbringen.
Wenn man bei einer gelingenden sozialen Hilfe im Segment der Problemstellung Arbeitslosigkeit, statt 60 Milliarden p. a. nur 10 Milliarden bräuchte, könnte man mit der eingesparten Summe richtig was machen. Bildung, Wohnen, Gesundheit, Umweltschutz, Mobilität, Kunst, Sport …
Aber wie soll Frau Bas, das der Frau Nahles bloß beibringen?
Letztere meint, alles richtig zu machen und stellt sich natürlich schützend vor ihr System. Schutzargument Nr. 1 in den letzten Jahren: „Die Gesamtarbeitslosigkeit von ca. 6 % ist doch gering – was wollt ihr? Wir sind doch so erfolgreich!“.
Beantwortung der Frage: sie (Frau Bas) wird alles so lassen wie es ist und schon immer war. Weiter so – im kaschierten Nicht-Erfolg. Sich gegen die Selbserhaltungskräfte des Sysytems BA zu wenden, ist zu nervenaufreibend und unpopulär.
Ca. 3 Millionen Arbeitslose – darunter viele Langzeitarbeitslose – bei mehreren Millionen offenen bzw. unbesetzten Stellen ist kein Ruhmesblatt für die BA und vor allem nicht für die Jobcenter.
Ein Plädoyer für ein überfälligen sozialpolitischen Pardigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik (und beiläufig ein Milliardensparprogramm).
1. Einleitung
Langfristige Arbeitslosigkeit stellt nicht nur eine individuelle Belastung dar, sondern hat tiefgreifende gesamtgesellschaftliche und volkswirtschaftliche Konsequenzen. Neben den direkten Kosten (Transferleistungen, Krankheitsfolgen, Resignation) entstehen hohe Folgekosten durch den dauerhaften Ausschluss von Menschen aus produktiven und sozialen Teilhabestrukturen. Trotz jahrzehntelanger Reformversuche ist die Vermittlungseffizienz vieler Arbeitsmarktinstitutionen nach wie vor ernüchternd. Dies legt nahe: Nicht allein Strukturen, sondern Grundhaltungen und Methodiken der sozialen Hilfe müssen neu gedacht werden.
Empowerment – verstanden als gezielte Stärkung individueller Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung – stellt dabei ein zukunftsfähiges Paradigma dar. Dieses Diskussionspapier argumentiert für eine konsequente Orientierung an Empowerment-Strategien im Bereich der arbeitsmarktbezogenen Sozialpolitik und zeigt auf, wie durch gezielte systemische und methodische Veränderungen sowohl Menschen als auch das Solidarsystem profitieren können.
2. Das Menschenbild als Grundlage
Ein zentrales Element sozialstaatlichen Handelns ist das zugrunde liegende Menschenbild. Inspiriert durch ein biblisch-humanistisches Verständnis, wie es etwa in 1. Korinther 12 zum Ausdruck kommt, wird der Mensch als Teil eines Ganzen betrachtet – mit individuellen Fähigkeiten, unveräußerlichem Wert und gesellschaftlicher Relevanz. Daraus folgen:
- Das Recht auf Teilhabe / Leistung
- Die Pflicht zur Förderung individueller Potenziale
- Die Aufgabe, Strukturen zu schaffen, die auf Stärkung statt auf Defizitverwaltung beruhen
3. Empowerment als Methodik
Definition (nach Rappaport, 1987):
Empowerment ist ein Prozess, durch den Individuen, Organisationen und Gemeinschaften Kontrolle über ihre Lebensumstände erlangen.
Zentrale Prinzipien:
- Partizipation: Betroffene sind Subjekte des Handelns, nicht Objekte.
- Ressourcenorientierung: Fokus liegt auf vorhandenen Stärken, nicht auf Defiziten.
- Selbstwirksamkeit: Aufbau von Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit.
- Systemkritik: Empowerment schließt strukturelle Veränderungen ein.
4. Arbeitslosigkeit und strukturelle Entmächtigung
Langzeitarbeitslosigkeit führt häufig zu:
- Identitätsverlust
- Gefühl der Nutzlosigkeit
- Sozialer Isolation
- Psychischen Erkrankungen
- Abbau von Kompetenzen und Selbstvertrauen
Diese Prozesse sind nicht nur individuell destruktiv, sondern systemisch selbstverstärkend. Klassische Unterstützungsformate (z. B. passives Fallmanagement, standardisierte Maßnahmen) greifen zu kurz, wenn sie nicht gezielt auf Eigenaktivierung setzen.
5. Kritik bestehender Strukturen
Beispiel: Die Vermittlungsquote von Jobcentern liegt bei durchschnittlich nur ca. 6 % p. a., während der Verwaltungsaufwand hoch bleibt. Dies spricht für:
- Ineffizienz
- Fehlanreize innerhalb der Organisationen
- Mangelnde Individualisierung
- Fehlendes Vertrauen in das Potenzial der Klient:innen
Eine realistische und notwendige Zielgröße wäre Vermittlungsquoten von 20–25 %, wie sie in innovativen, empowernden Programmen im In- und Ausland erreicht werden. Entsprechend müsste die Organisationsgröße der BA & Jobcenter sich von heute 100.000 Beschäftigen binnen 7 Jahren auf 30-50.000 reduzieren. Die frei werdenden Kapazitäten und Ressourcen können in anverwandten öffentlichen Einrichtungen einen sinnvollen Anschluss finden. Das muss attraktiv kommuniziert und umgesetzt werden. Denn erfolgreiche Soziale Hilfe sollte sich überflüssig machen.
6. Reformvorschläge: Empowerment-orientierte Arbeitsmarktintegration
Selbsterhaltende Systeme überwinden
Ein zentrales Problem bestehender Hilfestrukturen liegt in ihrer Tendenz zum institutionellen Selbsterhalt. Sozialbürokratien und Trägerstrukturen entwickeln häufig Eigenlogiken, in denen Erfolg nicht an Überflüssigkeit, sondern an Fallzahlen, Mittelabrufen und Maßnahmenzyklen gemessen wird. Damit geraten nicht selten die eigentlichen Ziele – Integration, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung – aus dem Fokus.
Ein erfolgreiches Hilfesystem muss jedoch darauf ausgelegt sein, sich selbst überflüssig zu machen. Die Wirksamkeit sozialer Hilfe zeigt sich darin, dass Menschen nicht dauerhaft auf sie angewiesen bleiben, sondern ihr Leben wieder selbstbestimmt führen können.
Damit dies realistisch möglich wird, sind strukturelle Voraussetzungen zu schaffen:
- Bedienstete und Fachkräfte im Hilfesystem benötigen attraktive Anschlussmöglichkeiten, etwa durch:
– Weiterbeschäftigung in angrenzende Berufsfeldern
– Qualifizierungsmaßnahmen für transformative Sozialarbeit
– Anreizsysteme für erfolgreiche Vermittlung und nachhaltige Integration - Statt Hierarchieerhalt braucht es lernende Organisationen, die Veränderung als Erfolg begreifen – nicht als Bedrohung.
Empowerment-gestützte Projekte sollten beinhalten:
- Stärkenbilanzierung statt standardisierter Defizitfeststellung
- Arbeitslose Menschen sollten Impulsgeber für Unterstützungsaktionen sein
- Coaching, Mentoring und Peer-Beratung als zentrale Instrumente
- Verbindliche Teilhabevereinbarungen, mit individuell vereinbarten Zielen
- Anschlussfähige Arbeitsmarktpfade durch enge Kooperation mit Unternehmen
- Förderung von Sozialunternehmertum als Übergangsmodell
- Vermittlung findet nicht im Kopf der Vermittler statt, sondern zwischen Arbeitgebern und Arbeitsuchenden
- Qualifizierung nur noch in Unternehmen
- „Anschluss“ statt „Match“
- Professionelle Personalentwicklung auch im Hilfesystem (modernes HRM) / hier Anbindung an HRM Systeme von Unternehmen
- …
7. Finanzielle und gesellschaftliche Perspektiven
Empowerment spart – nicht durch Kürzung, sondern durch klügeres Fördern:
- Reduktion chronischer Transferleistungen
- Geringere Krankheitskosten
- Erhöhte Steuer- und Sozialabgaben durch Reintegration
- Erhalt und Ausbau sozialer Kohäsion
8. Der politische und gesellschaftliche Auftrag
Die Politik muss den Mut aufbringen, veraltete, ineffiziente und selbsterhaltende Strukturen kritisch zu hinterfragen und durch reformfähige, adaptive Systeme zu ersetzen.
Dazu gehört auch eine ehrliche Evaluation der Wirkung sozialer Maßnahmen – und die Bereitschaft, Institutionen nur so lange aufrechtzuerhalten, wie sie tatsächlich zur Lösung beitragen.
Ein System, das Menschen befähigt, statt sie zu verwalten, braucht:
- Zieltransparenz: Erfolg heißt nicht „Fallzahlsteigerung“, sondern „Fallzahlreduktion durch Selbstständigkeit“.
- Personalpolitische Konzepte, die Fachkräfte nicht binden, sondern attraktive Anschlussmöglichkeiten anbietet.
- Politischen Willen, finanzielle Mittel nicht zur Systemerhaltung, sondern zur Systemerneuerung einzusetzen.
Notwendig ist:
- Mut zur strukturellen Erneuerung
- Interdisziplinäre Forschung (z. B. durch unabhängige Forschungsinstitute)
- Verbindliche Zielvorgaben an Arbeitsmarktinstitutionen
- Transparenz über Wirksamkeit sozialer Hilfen
- Partizipation Arbeitsloser an der Systemgestaltung
Empowerment ist keine sozialpädagogische Mode, sondern ein strukturwirksames Prinzip – „denn man hilft den Menschen nicht, wen man für sie tut, was sie selbst tun können.“
Es steht für eine menschenwürdige, wirtschaftlich rationale und zukunftsweisende Form sozialer Hilfe.
Es geht nicht um den Selbsterhalt von ineffizienten Strukturen, sondern um die Entfaltung menschlichen Potenzials, den Anschluss an wirtschaftliche Prozesse – und um das, was eine solidarische Gesellschaft im Kern ausmacht: Gegenseitige Verantwortung.
„Ein Hilfesystem ist dann erfolgreich, wenn es sich selbst überflüssig macht – und seine Fachkräfte nicht bindet, sondern für gebotene attraktive Anschlussmöglichkeiten freisetzt. Nicht institutionelle Stabilität ist das Ziel, sondern menschliche Souveränität.“
Außerdem geht es um sehr sehr sehr viel zu sparendes Geld der Solidargemeinschaft.
Eine kritische Wissenschaft dazu gibt es auch nicht, denn sie ist Teil des Systems der BA.
9. Literatur (Auswahl)
- Luhman, Niklas (1984) Soziale Systeme sowie (1997) Die Gesellschaft der Gesellschaft
- Rappaport, J. (1987): Terms of empowerment/exemplars of prevention. American Journal of Community Psychology
- Herriger, N. (2020): Empowerment – Theorien und Praxen.
- Scherr, A. (2013): Soziale Arbeit und Arbeitsmarktpolitik.
- Bundesrechnungshof (verschiedene Berichte zu Jobcenter-Effizienz)
- de – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung





