Politischer Brandschutz

Politischer Brandschutz

Wenn wir den Problemen nicht ins Auge sehen, machen sie mit uns, was sie wollen.
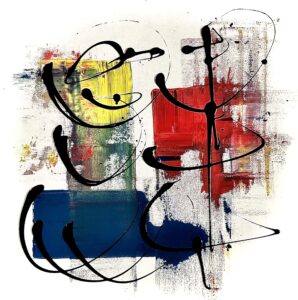
Die Zukunft von gestern ist heute.
Wer die Zukunft erfolgreich gestalten und die Probleme der Welt lösen will, darf ihnen nicht mit Überheblichkeit oder Allmachtsfantasien begegnen – mit Parolen wie:
- „Wir schaffen alles, wir zahlen alles, was wir tun ist alternativlos“.
Probleme lassen sich – ob global oder gesellschaftlich – nur bewältigen, wenn man mutig, realitätstauglich und vernunftorientiert handelt.
Vernunft ist die Fähigkeit des menschen, logisch zu denken, Zusammenhänge zu erkennen und auf dieser Grundlage kluge Entscheidungen zu treffen. Sie befähigt uns, objektiv zu analysieren, Argumente abzuwägen und nicht ausschließlich aus Emotion, Empathie oder Instinkt heraus zu handeln.
Das war gestern so, das ist heute so – und es wird auch morgen gelten:
Wer heute nicht das Richtige tut, prägt die Zukunft im Schlechten mit und hinterlässt Ballast.
„Erst durch die Gestaltwerdung von Geschichte und jenseits aller noch so ehrlich gemeinten Rechtfertigungsversuche der Handelnden wird festgestellt, welches die zeitgemäß angemessene Relation von Zwecken und Mitteln gewesen wäre.“
— Bazon Brock
Optimismus im Pessimismus
- Der Optimist sagt: Wir schaffen das.
- Der Pessimist sagt: Wir schaffen das nicht.
- Der optimistische Pessimist sagt: Wir schaffen das, was wir tatsächlich bewältigen können – und das kann sehr viel sein.
Diese Haltung verbindet Zuversicht mit Maß und Vernunft. Sie steht für realistischen Mut statt blinder Zuversicht in Form von: „Et hätt noch immer jot jejange“ – wir haben ja schließlich schon so vieles geschafft, dann schaffen wir das auch.
Vorsicht und Weitsicht aus Erfahrung
„Zuwanderung aus fremden Zivilisationen schafft mehr Probleme, als es uns auf dem Arbeitsmarkt an positiven Faktoren bringen kann. Zuwanderung aus verwandten Zivilisationen, zum Beispiel aus Polen, ist problemlos. … Zum Beispiel aus Anatolien ist nicht ganz problemlos. … Zum Beispiel aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. … Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung. Aber wegen der Art und Weise, wie sie … erzogen worden sind.“ Helmut Schmidt 2010.
Das Recht auf Asyl
Bei der Frage, was ein Staat leisten kann, stehen zwei Aspekte im Vordergrund:
- Besteht ein Recht auf Asyl? – gemäß Artikel 16a des Grundgesetzes.
- Ist die aufnehmende Gesellschaft in der Lage, Asyl menschenwürdig zu gewähren – also Nahrung, Unterkunft, Bildung und Arbeit bereitzustellen?
Das Recht auf Asyl wird am besten geschützt, wenn sein Missbrauch verhindert wird.
Das erfordert klare Regeln, konsequente Umsetzung und menschliches Augenmaß.
Die politische Brandmauer
Der Begriff Brandmauer stammt aus dem Brandschutz:
Eine Brandwand soll verhindern, dass Feuer auf andere Gebäudeteile übergreift.
Übertragen auf die Politik bezeichnet die „Brandmauer“ die entschiedene Abgrenzung demokratischer Parteien gegenüber extremistischen Kräften. Sie dient dem Schutz demokratischer Werte und Institutionen.
Doch:
- Eine Brandmauer darf nicht zum Vorwand werden, um sich hinter ihr zu verschanzen und die Ursachen des Feuers zu übersehen.
Brandbekämpfung statt Abschottung
Es ist besser, das Feuer jenseits der Brandmauer zu löschen, als nur die Widerstandskraft der Mauer zu testen.
Im übertragenen Sinn heißt das:
Es ist klüger, Asylmissbrauch durch klare und faire Regelungen zu begrenzen, als die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft zu überfordern – denn das nährt Unmut und Radikalisierung.
Eine feuerfeste Brandmauer gegen Rechtsextremismus ist notwendig.
Noch wirksamer aber ist es, durch vorausschauende Politik den Nährboden für Extremismus zu entziehen.
Was richtig ist – etwa eine Neuordnung der Asylpraxis zur Stärkung des Asylrechts – wird nicht dadurch falsch, dass auch die „Falschen“ zustimmen.
Im Gegenteil: Wirksame Brandbekämpfung nimmt den politischen Brandstiftern den Treibstoff.
Fazit
Eigentlich sollte es in der Welt nicht nötig sein, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen – doch das bleibt wohl eine Utopie.
Trotzdem darf die Weltgemeinschaft nicht nachlassen, Fluchtursachen wie Krieg, Armut und Missgunst gemeinsam zu bekämpfen.
Demokratie wird gestärkt, wenn politische und soziale Probleme sehenden Auges angegangen werden.
Sie wird geschwächt, wenn Politiker:
- kritische Fragen meiden,
- Andersdenkende pauschal diffamieren,
- oder unbequeme Themen aus Angst vor Machtverlust tabuisieren.
Demokratie lebt von Streit, nicht von Stigmatisierung.
Wer Kritik sofort in die „Feind-“ oder „Naziecke“ stellt, zeigt politische Hilflosigkeit.
- Vorsicht ist wichtig – doch sie darf nicht dazu führen, dass jeder, der nicht mein Freund ist, automatisch zum Staatsfeind erklärt wird.
Freunde sind diejenigen, vor denen man laut denken darf, selbst wenn ihnen das Gedachte nicht gefällt.
Diese Haltung eint Demokraten.
Ihre Gegner hingegen profitieren von Angst, Unsicherheit und Spaltung.
Aus der Geschichte lernen
„Wenn ich mich an historische Quellen richtig erinnere, sind gegen Nationalsozialisten in den Jahren 1923 bis 1933 mindestens 40 000 Prozesse geführt worden – mit 18 000 Jahren Gefängnisstrafen und 1,3 Millionen Reichsmark Strafgeldern. Belegen diese Tatsachen, dass Staatsanwälte und Richter der Weimarer Republik ihre Pflichten sträflich vernachlässigt hätten, weil sie auf dem rechten Auge blind waren?
Nein. Die Bonner Republik wird umso stärker gefährdet, je mehr wir den Gerichten aufnötigen, uns politische und soziale Fragen vom Halse zu halten.
Was hat es den Weimarianern genützt, Hitler Rede- und Auftrittsverbot zu erteilen?
Es wird auch uns nichts nützen, Radikale aller Couleur gerichtlich kassieren zu lassen, wenn Bürger ihnen folgen, weil sie glauben, dass wir nur noch leeres Stroh dreschen und uns hinter Richtern verkriechen.“
— Bazon Brock, Frankfurter Rundschau, 10. September 1994
Eine Demokratie verteidigt sich nicht allein durch Abgrenzung und Gerichte, sondern durch Glaubwürdigkeit, Vernunft und die Fähigkeit, Probleme zu lösen.
Schlussgedanke
Eine Brandmauauer kann helfen – sie ist aber nicht das Entscheidende. Politischer Brandschutz heißt: Probleme erkennen, Ursachen bekämpfen, Feuer löschen – nicht Mauern errichten und hoffen, dass die Flammen draußen bleiben.
Demokratie braucht Mut, Vernunft und den Willen, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Nur dann bleibt sie widerstandsfähig gegen die Brände, die sie von innen und außen bedrohen.






