Helfen – als Profession / Problemfeld Arbeitslosigkeit (Kurzversion)
work in progress (August 2025)
Das Buch, „Helfen – als Profession“ ist in der Entstehung. Die vorläufige Kurzversion mit Inhaltsverzeichnis zeigt die Richtung, in die es gehen wird.
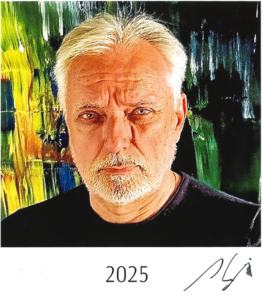
Autor: Ich heiße Henryk Cichowski, bin Sozialwissenschaftler und Unternehmer mit 30jähriger praktischer Erfahrung im Themenfeld der „Arbeitsmarktintegration / HRM“.
Mit diesem Buch verfolge ich kein kommerzielles und kein ideologisches oder moralisches Anliegen, sondern ein praktisches Ziel:
„Soziale Hilfe soll wirksam, menschlich und wirtschaftlich tragfähig sein – und sich idealerweise selbst überflüssig machen“.
Die Praxis der Sozialen Hilfe muss sich am Erfolg messen lassen. Denn wenn sie sich als erfolglos erweist, ist Veränderung unausweichlich.
Das ist wie im Leben:
„Wer den Tatsachen nicht ins Auge schauen will, mit dem machen die Tatsachen, was sie wollen. Meistens geht das nicht gut aus.“
Es schreit aufgrund der Tatsachen nach unbequemer Veränderung – vielen, die sich eingerichtet haben wird eine solche Herausforderung nicht passen. Sie werden versuchen, sie moralisierend oder ideologisch zu bekämpfen. Aber es lässt sich halt nichts schönreden.
Es wird ein Buch für alle, die soziale Gerechtigkeit nicht nur faktenbasiert fordern, sondern wirksam gestalten wollen.

Helfen – als Profession (Problemfeld Arbeitslosigkeit)
Helfen gehört zu unserem Alltag. Wir helfen Freunden, Familie oder Nachbarn, wenn sie Probleme haben oder Unterstützung brauchen. Das alltägliche Helfen ist primär durch persönliche Beziehungen und informelle Interaktionen gekennzeichnet – Liebe bzw. Nächstenliebe pur.
Im Gegensatz dazu versteht sich professionelles Soziales Helfen als systematische und methodisch fundierte Tätigkeit, die von qualifizierten Fachkräften in institutionalisierten Kontexten innerhalb rechtlicher Vorgaben ausgeübt wird.
Die professionelle Soziale Hilfe ist eine der zentralen Aufgaben unseres Sozialstaats – und dennoch bleibt ihre Wirkung oft hinter den Erwartungen zurück.
Wie wir sie heute organisieren – besonders im Bereich Arbeitslosigkeit – ist häufig ineffizient, entmündigend und teuer.
Also Frust für alle Beteiligten: für Arbeitslose, für Helfende, für Arbeitgeber, für die Solidargemeinschaft, für die Politik und auch für eine derzeit nicht unabhängige Arbeitsmarktwissenschaft.
Das eingesetzte Geld arbeitet nicht erfolgreich und wird andernorts dringend benötigt.
Warum ist das so? Und wie kann man es besser machen?
Mein Buch wirft einen ungeschönten, aber lösungsorientierten Blick auf die Strukturen, Routinen und blinden Flecken unseres Hilfesystems – insbesondere im Kontext von Arbeitslosigkeit.
Es beleuchtet, wann Hilfe wirklich hilft, wann sie schadet, und warum „gut gemeint“ oft nicht „gut gemacht“ ist.
Die zentralen Thesen sind:
- Jeder Mensch kann etwas (Stärken), wird gebraucht (Leistung / Teilhabe) und ist wichtig (Würdigung) – (Bibel – Korinther 12).
- Menschen haben (leider) einen Hang zur Bequemlichkeit – (Immanuel Kant).
- Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können – (Abraham Lincoln).
- Hilfesysteme neigen nicht dazu, sich überflüssig zu machen (Niklas Luhmann).
- Soziale Hilfe muss sich daran messen lassen, ob sie Menschen wirklich stärkt – und sich im Idealfall danach tatsächlich selbst überflüssig macht.
Fundiert, kritisch und klar benannt werden:
- die Widersprüche im bestehenden System,
- die strukturellen Hindernisse für echte Wirksamkeit,
- konkrete Reformvorschläge für Politik, Praxis und Gesellschaft.
Veränderung ist immer anstrengend – aber sie ist möglich.
Der Schlüssel: Menschen in ihren Stärken und in ihrer Selbstwirksamkeit ernst nehmen. Strukturen und Herangehensweisen mutig hinterfragen. Und dann: TUN (Stärken – Ressourcen – Anschluss).
Helfen – aber bitte richtig. „Denn echte Hilfe erkennt man daran, dass sie nicht gebraucht wird, wenn sie gewirkt hat.“
Dieses Buch liefert:
- eine praxisnahe Systemkritik mit lösungsorientierten Reformvorschlägen,
- sowie eine neue Sozialidee mit realpolitischer Umsetzbarkeit.
Es soll Denkanstöße geben – und zum richtigen und guten Tun motivieren.
„Ungeachtet der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und des damit verbundenen Rückgangs der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit sensibilisieren die Forschungsbefunde der letzten Jahre zugleich dafür, dass ein Teil der Leistungsberechtigten langfristig, womöglich sogar dauerhaft kaum eine Chance auf eine ungeförderte Beschäftigung und die damit verbundenen Teilhabechancen haben dürfte„. IAB
„Konsequenzen bei Erfolglosigkeit der Jobcenter. Sollte dies absehbar nicht gelingen und sich die Heterogenität vielmehr als eine dauerhafte strukturelle Überforderung der Grundsicherung erweisen, so wären grundsätzlichere Überlegungen zur Weiterentwicklung des Sozialstaats nötig, die die Vorstellung, dass sich ganz unterschiedliche Problemlagen im Rahmen eines einheitlichen Systems lösen lassen, kritisch hinterfragen“. ebenda IAB
Mehr Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung = mehr echte Solidarität.
 Struktur des Buches (Kapitelübersicht) – Work in Progress – Stand August 2025
Struktur des Buches (Kapitelübersicht) – Work in Progress – Stand August 2025
Helfen – als Profession. Systemkritik, Vision und Reformvorschläge am Beispiel Arbeitslosigkeit
Einleitung
Helfen ist eine zentrale Aufgabe des Sozialstaats. Doch im Bereich Arbeitslosigkeit zeigt sich: gute Absichten reichen nicht aus. Die derzeitigen Strukturen sind teuer, komplex und oft wenig wirksam. Dieses Buch wirft einen faktenbasierten, kritischen und lösungsorientierten Blick auf die Praxis der Hilfe – mit dem Ziel, sie menschlich, wirksam und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.
TEIL I: HELFEN ALS PROFESSION – GRUNDLAGEN
Hilfe im Alltag beruht auf Nähe und Beziehung, professionelle Hilfe dagegen auf Systematik, Qualifikation und Institutionen. Entscheidend ist das zugrundeliegende Menschenbild: Wird der Mensch als aktiver Gestalter gesehen oder als passiver „Fall“? Erfolgreiche Hilfe bedeutet Empowerment: Sie muss Kompetenzen, Motivation und Handeln zusammenführen. Nur dann entsteht Selbstwirksamkeit statt Abhängigkeit.
Kapitel 1: Was ist Soziale Hilfe?
- Alltagshilfe vs. Professionelle Hilfe
Alltägliche Hilfe beruht auf persönlichen Beziehungen, Vertrauen und Freiwilligkeit. Professionelle Soziale Hilfe dagegen ist institutionell organisiert, methodisch fundiert und rechtlich geregelt. Sie muss fachliche Standards erfüllen und zugleich ihre Wirkung belegen. - Das Menschenbild im sozialen Handeln
Ob Hilfe stärkt oder schwächt, hängt wesentlich vom zugrundeliegenden Menschenbild ab. Wird der Mensch als aktives Subjekt gesehen, das Fähigkeiten entwickeln und Verantwortung übernehmen kann – oder als passives Objekt, das „verwaltet“ werden muss? - Motivation allein reicht nicht aus, auf die Umsetzung kommt es an
Gute Absichten sind keine Garantie für gute Wirkungen. In der professionellen Hilfe zählt nicht nur Motivation, sondern vor allem die Qualität der Methoden, die Wirksamkeit der Strukturen und die Konsequenz in der Umsetzung.
Kapitel 2: Schlüssel erfolgreicher Hilfe
- Können – Wollen – Tun
Wirksamkeit entsteht nur, wenn Kompetenzen (Können), Motivation (Wollen) und Umsetzung (Tun) zusammenkommen. Fehlt eines dieser Elemente, bleibt Hilfe wirkungslos. - Hilfe zur Selbsthilfe
Nachhaltige Hilfe unterstützt Menschen darin, ihre eigenen Fähigkeiten zu aktivieren. Wer nur für andere handelt, verstärkt Abhängigkeit. Hilfe muss Übergänge ermöglichen, nicht Dauerversorgung. - „Man hilft Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können“ (Lincoln)
Dieses Prinzip beschreibt das Spannungsfeld professioneller Hilfe: Entlastung ist manchmal notwendig, aber entscheidend ist, Menschen wieder in ihre Selbstwirksamkeit zu führen.
Kapitel 3: Verantwortung und Selbstwirksamkeit
- Der Mensch als Individuum und Gesellschaftswesen
Individuen gestalten ihr Leben selbst, sind aber zugleich Teil von Gemeinschaften. Hilfe muss beide Ebenen berücksichtigen: die persönliche Autonomie und die soziale Eingebundenheit. - Verantwortung hat zwei Seiten
Hilfe erfordert Verantwortungsübernahme sowohl durch die Hilfesuchenden (Eigenverantwortung) als auch durch die Gesellschaft (Solidarität). Einseitige Verantwortung führt zu Ungleichgewicht. - Eigenwohl und Allgemeinwohl im Spannungsverhältnis
Soziale Hilfe balanciert individuelle Bedürfnisse mit gesellschaftlichen Ressourcen. Dauerhafte Hilfe für Einzelne darf nicht zur Überlastung der Gemeinschaft führen – ebenso wenig darf Effizienz über Menschlichkeit gestellt werden. - Der Mensch als Lebensgestalter – oder Opfer?
Ob Menschen ihre Rolle aktiv gestalten oder sich passiv als Opfer sehen, beeinflusst maßgeblich den Erfolg von Hilfesystemen. Professionelle Hilfe muss Menschen in die aktive Rolle zurückführen.
TEIL II: DAS SYSTEM DER SOZIALEN HILFE – UND SEINE WIDERSPRÜCHE
Der Sozialstaat will Sicherheit geben, produziert aber durch Bürokratie und Standardisierung häufig Entmündigung. Grundsicherung wird so oft zur Falle, weil sie zwar das Überleben sichert, aber kaum Wege in Eigenständigkeit eröffnet. Hilfesysteme verharren in Routinen, die sich selbst stabilisieren, statt sich überflüssig zu machen.
Kapitel 4: Wie Hilfe organisiert ist – und wo sie scheitert
- Hilfe im Sozialstaat – rechtlich, institutionell, bürokratisch
Das deutsche Hilfesystem ist stark rechtlich normiert und institutionell verankert. Diese Struktur soll Verlässlichkeit und Gleichbehandlung sichern, führt aber oft zu Starrheit und Bürokratismus. Komplexe Vorschriften erschweren individuelle Lösungen und kosten Ressourcen. - Warum das System oft entmündigt, statt stärkt
Standardisierte Verfahren behandeln Menschen häufig als „Fälle“ und nicht als handelnde Subjekte. Dadurch wird Eigeninitiative gehemmt, und Abhängigkeit entsteht, anstatt Selbstwirksamkeit zu fördern. - Strukturen, die Hilfe verhindern
Paradoxerweise schaffen manche Regelungen Hindernisse: Sanktionen, Bürokratie und Kontrolllogik können Hilfebedarf zementieren. Hilfesysteme riskieren, ihre eigenen Ziele zu unterlaufen. - Hilfe, die bleibt, obwohl sie „gewirkt“ haben sollte
Wenn Leistungen dauerhaft fortbestehen, obwohl Menschen eigentlich wieder eigenständig sein könnten, ist das ein Zeichen ineffektiver Strukturen. Hilfe muss Übergang sein – kein Dauerzustand. - Hilfesysteme müssen sich überflüssig machen, nur dann waren sie erfolgreich
Ein System, das seine eigene Existenz rechtfertigt, verliert seine Legitimation. Erfolg misst sich daran, ob Menschen wieder ohne Hilfe auskommen können.
Kapitel 5: Grundsicherung – Hilfe oder Falle?
- Leistungen zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit
Das gesetzliche Ziel der Grundsicherung ist klar: sie soll Hilfebedürftigkeit überwinden helfen. In der Praxis jedoch bleibt sie oft ein bloßes Sicherungsinstrument ohne nachhaltige Integrationswirkung. - Kann man ohne Arbeit leben – mit Hilfe des Staates?
Die Grundsicherung ermöglicht materielles Überleben, verhindert aber nicht zwingend dauerhafte Erwerbslosigkeit. Sie kann ungewollt Anreize zur Passivität schaffen, wenn Perspektiven fehlen. - Wer zahlt, will Wirkung – aber welche?
Die Finanzierung durch Steuergelder setzt Erwartungen an Effizienz und Wirkung. Doch Erfolg wird meist rechtlich-formal gemessen, nicht daran, ob Menschen tatsächlich wieder in Arbeit und Teilhabe kommen. - Erlernte Hilflosigkeit & der Teufelskreis der Passivierung
Langfristige Leistungsbezüge können Selbstvertrauen und Motivation schwächen. Statt Selbstverantwortung zu fördern, entsteht das Risiko einer Abhängigkeitsspirale, die Integration immer unwahrscheinlicher macht.
TEIL III: ARBEITSLOSIGKEIT ALS KRISENFELD DER HILFE
Langzeitarbeitslosigkeit bleibt trotz starker Wirtschaft eine feste Größe. Institutionen erklären dies mit „Mismatch“, „Marktferne“ oder persönlichen Defiziten bzw. multiplen Hemmnissen – doch diese Narrative stabilisieren eher das System, als dass sie Lösungen schaffen. Die Arbeitsverwaltung scheitert an ihrem Anspruch, weil ihre Instrumente standardisiert, kurzatmig und oft wirkungslos sind. Wirksames Tun wird zu selten von wirkungslosem Routinehandeln unterschieden.
Kapitel 6: Die Realität der Langzeitarbeitslosigkeit
- Zahlen, Daten, Fakten
In Deutschland sind aktuell3 Millionen Menschen arbeitslos, über eine Millionen (34 % aller Arbeitslosen) sind länger als ein Jahr ohne Arbeit. Trotz insgesamt guter Arbeitsmarktentwicklung bleibt diese Gruppe weitgehend stabil. Langzeitarbeitslosigkeit ist damit weniger ein konjunkturelles, sondern vor allem ein strukturelles Problem. - Die typischen Erzählmuster der Institutionen
– Hemmnisse: Gesundheitliche Einschränkungen, fehlende Qualifikationen oder soziale Probleme werden als Hauptursachen genannt, oft ohne differenzierte Analyse.
– Mismatch: Angeblich passen Bewerber und offene Stellen nicht zueinander – doch häufig liegt es eher an unflexiblen Vermittlungslogiken.
– Marktferne: Betroffene werden als „nicht arbeitsmarktnah“ kategorisiert, was ihre Chancen faktisch reduziert.
– Schlechte Arbeit: Niedriglohn- und prekäre Beschäftigung wird als unattraktiv dargestellt, wodurch eine Rückkehr in Arbeit als unzumutbar erscheinen kann. - „Die Guten sind weg“ und andere Mythen
Die Behauptung, die Arbeitslosen seien per se „nicht vermittelbar“, ist empirisch widerlegt. Studien zeigen, dass bei richtiger Unterstützung viele Betroffene sehr wohl wieder eingegliedert werden können. Mythen stabilisieren eher die Hilfestrukturen, als dass sie Lösungen bieten.
Kapitel 7: Die Grenzen der Arbeitsverwaltung
- Vermittlung – Anspruch und Wirklichkeit
Die Arbeitsverwaltung verspricht schnelle und passgenaue Vermittlung. In der Realität gelingt es nur selten, nachhaltige Übergänge zu schaffen – die Erfolgsquoten liegen weit unter den gesellschaftlichen Erwartungen. - Die Instrumente im Überblick (4PM, Aktivierung, Weiterbildung …)
Es existiert ein umfangreicher Katalog an Maßnahmen: Aktivierung, Qualifizierung, öffentlich geförderte Beschäftigung. Viele Instrumente wirken kurzfristig, entfalten aber kaum nachhaltigen Integrationseffekt. - Wenn Hilfe standardisiert – aber nicht individualisiert wird
Maßnahmen werden oft nach Schema F vergeben. Diese Standardisierung spart Verwaltungsaufwand, geht aber an den individuellen Bedürfnissen und Stärken der Betroffenen vorbei. - Wirkungsloses Tun vs. wirksames Lassen
Nicht jede Aktivität ist automatisch wirksam. Häufig bindet das System Ressourcen in wenig effektive Maßnahmen, während Freiraum für echte Lösungen fehlt. Manchmal wäre ein bewussteres „Weglassen“ von Routineinstrumenten wirksamer als ihr standardisierter Einsatz.
TEIL IV: WAS WIR BESSER MACHEN KÖNNEN – UND WIE
Europa und Deutschland kennen Modelle, die Mut machen: Sie setzen auf individuelle Verantwortung, enge Unternehmenskooperation und Lernen in der Praxis. Der notwendige Paradigmenwechsel bedeutet: Empowerment statt Betreuung, Anschluss statt Match, Stärkenorientierung statt Defizitfokus. Jobcenter müssen Potenzialagenturen werden, unabhängig von bürokratischen Fesseln, mit Arbeitgebern als Partnern und Betroffenen als Mitgestaltenden.
Kapitel 8: Beispiele, die Mut machen
- Erfolgreiche Modelle in Deutschland und in Europa
Es gibt zahlreiche lokale und europäische Ansätze, die Arbeitslose erfolgreich in Beschäftigung bringen – z. B. „Work First“-Programme, sozialunternehmerische Integrationsbetriebe oder arbeitsplatzbezogene Weiterbildung in Unternehmen. Entscheidend ist meist die Nähe zum Arbeitsmarkt, nicht die Distanz über Maßnahmen. - Was wir von ihnen lernen können
Best Practice-Modelle zeigen: individuelle Begleitung, Kooperation mit Arbeitgebern und echte (federführende) Verantwortung der Teilnehmenden erhöhen die Wirksamkeit. Erfolg basiert weniger auf Regulierung, sondern auf Stärken, Vertrauen, Eigenverantwortung und pragmatischer Passgenauigkeit.
Kapitel 9: Der Paradigmenwechsel – Hilfe neu denken
- Empowerment statt Betreuung
Statt Menschen zu verwalten, müssen Hilfesysteme ihnen ermöglichen, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen. Empowerment bedeutet: aktivieren statt versorgen. - Selbstbestimmung statt Verwaltung
Bürokratische Verfahren verhindern oft echte Wahlmöglichkeiten. Hilfe wird nur wirksam, wenn sie individuelle Entscheidungen respektiert und Selbststeuerung zulässt. - Stärkenorientierung statt Defizitblick – über Stärken Anschluss herstellen
Menschen finden leichter Zugang zum Arbeitsmarkt über das, was sie können – nicht über Defizite. Stärkenorientierung schafft Motivation, Selbstwert und Anschlussmöglichkeiten. - Dialog auf Augenhöhe – Arbeitslose in federführender Rolle der Gestaltung
Betroffene müssen nicht Objekte, sondern Akteure der Hilfegestaltung sein. Partizipation fördert Verantwortung und nachhaltige Ergebnisse. - Orientieren, Lernen und Anschluss finden in Unternehmen
Unternehmen sind der Ort realer Anforderungen. Qualifizierung in der Praxis ist wirksamer als schulische Ersatzmaßnahmen. - Prozesse der Vermittlung: Anschlussoperationen statt Matching-Frust
Statt auf ein „perfektes Matching“ zu warten, braucht es flexible Übergänge. Anschlussdenken ermöglicht Lernen im Prozess und verhindert Stillstand. - Hilfe als Entwicklung, nicht als Dauereinrichtung
Hilfe soll Übergänge begleiten, nicht Abhängigkeiten verstetigen. Entwicklung ist das Kriterium, Dauer das Problem.
Kapitel 10: Eckpunkte einer neuen Arbeitsmarktpolitik
- Integration statt Verwaltung
Arbeitsmarktpolitik muss die Rückkehr in Arbeit als Hauptziel haben – nicht die bloße Abwicklung von Leistungen. - Vermittlung als „Anschluss“ statt „Match“
Erfolgreiche Integration heißt: Übergänge organisieren, nicht perfekte Übereinstimmungen abwarten. - Berufliche Orientierung und Weiterbildung nur in Unternehmen
Praxisnähe ist entscheidend – Lernen im Arbeitskontext wirkt nachhaltiger als abstrakte Maßnahmen. - Arbeitgeber als Mitverantwortliche (OE, PE und HRM-Systeme der Unternehmen nutzen)
Unternehmen sind zentrale Partner im Integrationsprozess. Ihre Personal- und Organisationsentwicklung muss stärker eingebunden werden. - Jobcenter als Ermöglichungsorte (Potenzialagenturen) – nicht als Verwaltungsapparate
Zukunftsfähige Jobcenter konzentrieren sich auf Potenziale, nicht auf Kontrolle. Sie fördern Aktivierung und Selbstverantwortung. - Jobcenter der Zukunft sind organisatorisch unabhängig von der BA
Eine institutionelle Trennung schafft Freiheit für Innovation und verhindert Zielkonflikte. - Aktivierung ist alleinige Aufgabe von Jobcentern (keine Vergaben mehr)
Externe Vergaben führen oft zu Streuverlusten. Direkte Verantwortung im Jobcenter stärkt Qualität und Verbindlichkeit. - Professioneller Einsatz von Gruppenarbeit und Gruppendynamik
Gruppensettings fördern Motivation, Peer-Learning und gegenseitige Verantwortung – Ressourcen, die in Einzelfallbearbeitung oft verloren gehen. - IAB als wissenschaftliche Einrichtung wird von der BA getrennt
Unabhängigkeit in der Forschung ist Grundvoraussetzung für belastbare Evaluation und Politikberatung. - Jährliche Wirksamkeitsprüfung durch externes Gremium
Transparenz und Kontrolle sichern Glaubwürdigkeit. Effizienz muss messbar sein. - 6 % Vermittlungserfolg ist nicht akzeptabel
Die bisherigen Quoten liegen deutlich unter dem, was mit konsequenter Praxisnähe erreichbar wäre. Zielgrößen müssen ambitionierter sein.
TEIL V: DER PLAN ZUR UMSTEUERUNG
Reform bedeutet, das System konsequent auf Wirksamkeit auszurichten: Qualifizierung nur dort, wo Arbeit ist, Vermittlung als Anschlussprozess, Kooperation mit Unternehmen statt Maßnahmenkarussell. Wirkungsorientierung braucht unabhängige Evaluation und realistische, ambitionierte Ziele – mindestens 20 % Vermittlung pro Jahr. Nur so lassen sich Milliarden sparen, die für Bildung, Pflege oder Klimaschutz dringend gebraucht werden.
Kapitel 11: Systemische Reformvorschläge
- Leistungsgewährung neu gedacht
Statt bloßer Absicherung braucht es eine wirksame Verknüpfung von Leistung und Integration. Leistungen sollten an klare Entwicklungs- und Teilhabeziele gekoppelt sein. - Berufsberatung in der Schule
Frühe Orientierung verhindert spätere Fehlentscheidungen. Schulen können entscheidend zur Arbeitsmarktintegration beitragen, wenn Berufsberatung praxisnah und verpflichtend erfolgt. - Vermittlung auf Augenhöhe – praxisnah und marktnah
Vermittlung darf nicht hierarchisch oder formalistisch sein. Nur ein echter Dialog mit Arbeitsuchenden und Arbeitgebern schafft tragfähige Übergänge. - Weg vom Match – hin zum Anschluss
Perfekte Passung ist selten. Erfolgreich ist, wer Menschen über Übergangsprozesse in den Arbeitsmarkt integriert – „Lernen im Tun“ statt Stillstand. - Qualifizierung nur dort, wo Arbeit auch ist
Theorie allein bringt wenig. Qualifizierung muss in realen Betrieben stattfinden, damit Lernen direkt anschlussfähig ist. - Kooperation mit Unternehmen – HRM statt Maßnahmenkarussell
Statt abstrakter Förderlogik braucht es konkrete Partnerschaften mit Unternehmen. Personalentwicklung im Betrieb ersetzt das ineffektive Maßnahmensystem.
Kapitel 12: Wirkungsorientierung & Evaluation
- Wer misst die Wirkung – und wie?
Wirkung muss unabhängig und transparent gemessen werden. Erfolgsmaßstab ist nicht die Anzahl der Maßnahmen, sondern die nachhaltige Integration in Arbeit. - Was wäre ein realistisches Ziel?
Eine Vermittlungsquote von mindestens 20 % jährlich gilt als ambitioniert, aber erreichbar. Sie würde die Effizienz der Jobcenter verdreifachen und Kosten massiv senken. - Die Rolle der Wissenschaft bzw. Forschung – unabhängig von der BA
Forschung darf nicht Teil der Verwaltung sein, die sie gleichzeitig evaluieren soll. Nur unabhängige wissenschaftliche Institutionen können Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit sichern.
ABSCHLUSS UND AUSBLICK
Hilfe darf kein Dauerzustand sein, sondern muss Transformation ermöglichen. Wer wirklich hilft, macht sich überflüssig – das ist kein Verlust, sondern der größte Erfolg professioneller Hilfe. Ein Sozialstaat, der auf Wirksamkeit, Selbstverantwortung und Stärken setzt, wird nicht nur Armut überwinden, sondern auch neue Ressourcen für die Gesellschaft freisetzen. Sozial ist, wer die richtigen Dinge gut tut.
Kapitel 13: Schlussplädoyer
- Armut wirklich bekämpfen – statt nur verwalten
Armut darf nicht dauerhaft mit Geld verwaltet, sondern muss durch echte Teilhabe überwunden werden. Hilfe ohne Ausstiegsperspektive ist unsozial. - Was echte Hilfe ist: Erkennen, wo sie endet
Professionelle Hilfe muss sich überflüssig machen. Dauerhilfe ist ein Zeichen von Scheitern, nicht von Erfolg. - Was wir mit eingespartem Geld tun könnten
Selbst moderate Effizienzgewinne würden Milliarden freisetzen – für Bildung, Pflege, Klimaschutz und soziale Infrastruktur. - Eine neue Sozialidee für eine starke Gesellschaft
Sozial ist, wer die richtigen Dinge gut tut: Wirksamkeit, Selbstverantwortung und Stärkenorientierung sind die Eckpfeiler einer modernen Sozialpolitik. - Sozial ist, wer die richtigen Dinge gut tut
Dieser Leitgedanke bündelt die Vision: weniger Verwaltung, mehr Wirksamkeit – weniger Abhängigkeit, mehr Selbstbestimmung.

Schlussplädoyer – Helfen, das wirklich hilft
„Sozial ist am Ende nur der, der die richtigen Dinge gut tut.“
Wir leben in einem Sozialstaat, der stolz auf seine Hilfesysteme ist – und das zu Recht. Doch Stolz allein genügt nicht. Denn wir dürfen uns nicht mit gut gemeinten Strukturen zufriedengeben, wenn sie ihre Wirkung verfehlen, Menschen entmündigen oder sie gar dauerhaft in Hilfsbedürftigkeit halten. Der Maßstab muss lauten: Wirksamkeit. Und Wirksamkeit heißt: Menschen zu stärken – nicht sie zu verwalten.
Hilfe, die bleibt, obwohl sie gewirkt haben sollte, ist keine Hilfe.
Der zentrale Anspruch professioneller Hilfe muss sein: sich überflüssig zu machen. Das bedeutet nicht, dass Hilfe generell verzichtbar ist – im Gegenteil: Sie ist existenziell, wenn Menschen in Not geraten, wenn soziale Teilhabe gefährdet ist oder wenn Lebenskrisen Menschen lähmen. Doch Hilfe muss immer ein Sprungbrett sein, kein Netz, das zur Hängematte wird. Sie muss Übergang sein – nicht Dauerzustand.
Die Sozialpolitik braucht einen Perspektivwechsel.
Es braucht nicht mehr Maßnahmen, sondern mehr Ermöglichung. Nicht mehr Kontrolle, sondern mehr Vertrauen. Nicht mehr Verwaltung, sondern Begegnung auf Augenhöhe. Denn der Mensch ist kein Fall – er ist Subjekt, Akteur und Teil der Lösung. Eine echte Sozialpolitik traut den Menschen etwas zu, statt ihnen ständig zu misstrauen.
Die aktuelle Arbeitsmarktpolitik ist teuer, aber nicht wirksam. Sie ist komplex, aber nicht zielführend. Sie ist gut gemeint – aber oft schlecht gemacht. Die Milliarden, die wir jährlich investieren, erreichen zu wenig, bewirken zu wenig, belasten zu viele und verpuffen am Ende im System. Das darf kein Dauerzustand sein.
Der ideologische oder auch scheinheilige Schrei nach dem „Weiter so wie bisher“, nur mit noch mehr Milliarden, soll mit moralischen Vorwürfen gegen alle Kritiker die Realität verschleiern und ist überdies intellektuell irritierend und im Hinblick auf eine echte Veränderung wenig anspruchsvoll. Motto hier: „viel hilft viel“ und „noch mehr hilft noch mehr“.
Man kann auch in hoher Qualität ununterbrochen das Falsche gut tun. Am Ende klopfen sich dann alle auf die Schulter und sind stolz auf das geleistete (Falsche).
Wir brauchen Mut zur Veränderung – nicht aus Prinzip, sondern aus Verantwortung.
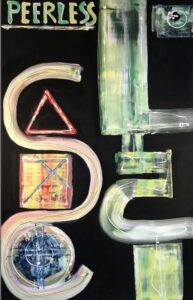 Die Konzepte liegen auf dem Tisch:
Die Konzepte liegen auf dem Tisch:
- Stärkenorientierung statt Defizitfokus.
- Selbstverantwortung statt Betreuung.
- Anschluss statt Match.
- Arbeitsmarktintegration statt Verwaltungsakte.
- Empowerment statt Resignation.
- Jobcenter (Potenzialagenturen) der Zukunft sind organisatorisch unabhängig von der BA.
- Aktivierung ist alleinige Aufgabe der Jobcenter (keine Vergaben mehr).
- Innovative Gruppenarbeit mit aktivierender Gruppendynamik.
- Shared Decision Making und Service Individualisierung bei der Entscheidungsfindung.
- Arbeitslose Menschen verantworten und steuern ihren eigenen Erfolg mit.
- Kooperation mit Unternehmen (HRM) statt Förderlogik.
- Orientierung und Bildung findet nur noch in Unternehmen statt.
- Wirksamkeit statt bloßer Rechtskonformität.
- Laufende Prüfung der Wirksamkeit der Jobcenter durch unabhängige Sachverständige.
- Eine unabhängige Arbeitsmarktwissenschaft
Die soziale Frage des 21. Jahrhunderts lautet: Wie befähigen wir Menschen und Menschen sich selbst zur Teilhabe – unabhängig von Herkunft, Biografie oder bisherigem Scheitern? Und die Antwort beginnt mit einer Haltung: Menschen können, wollen und sollen. Unsere Aufgabe ist es, sie darin zu unterstützen – nicht zu ersetzen. Allerdings wissen wir auch, dass Menschen einen Hang zur Bequemlichkeit besitzen. Dem gilt es, klug entgegenzuwirken.
Was wäre, wenn …?
Stellen wir uns vor, wir könnten nur 20 % der heutigen Ausgaben durch klügere, wirksamere und mutigere Konzepte einsparen. Dann würden jedes Jahr Milliarden frei – für Bildung, Pflege, Kinder, Quartiere, Klimaschutz, Kultur. Für alles, was Menschen stark und Gesellschaft lebenswert macht. Diese Vision ist kein Traum – sie ist machbar.
Doch dazu braucht es politische Klarheit, gesellschaftliche Reife, keine Ideologien und falsche Moralvorstellungen sowie eine professionelle Demut: Denn wer wirklich hilft, macht sich überflüssig. Das ist kein Verlust. Es ist der höchste Erfolg professioneller Hilfe.
Die Personalstärke der öffentlichen Arbeitsmarktinstitutionen sollte sich bei anhaltendem Integrationserfolg innerhalb von 7 Jahren von derzeit über 100,000 Beschäftigten auf dann 30-50.000 Beschäftigten dynamisch reduzieren lassen. Für einen attraktiven Anschluss in verwandten öffentlichen Berufsfeldern sollte gesorgt werden. Aufgrund des anhaltenden demographischen Wandels dürfte das kein Problem sein.
Zum Behalten:
✔ Jeder Mensch kann etwas, wird gebraucht und ist wichtig (keine Ausreden mehr).
✔ Soziale Hilfe darf nicht zur Gewohnheit werden – sie muss Transformation ermöglichen.
✔ Der Mensch ist kein Objekt von Hilfe, sondern Subjekt seiner Entwicklung. Also trägt er Verantwortung und will gefordert werden.
✔ Wer helfen will, muss loslassen können.
✔ Systeme der sozialen Hilfe müssen sich überflüssig machen.
✔ Wer Steuermittel verwaltet, trägt Verantwortung für echte Wirkung.
✔ Wir brauchen ein neues Sozialverständnis – pragmatisch, wirksam, menschlich.
✔ Eine Vermittlungsquote von mindestens 20 % p. a. ist eine realistische Zielgröße. Entsprechend verjüngen sich auch die Hilfestrukturen und die Ausgaben.





